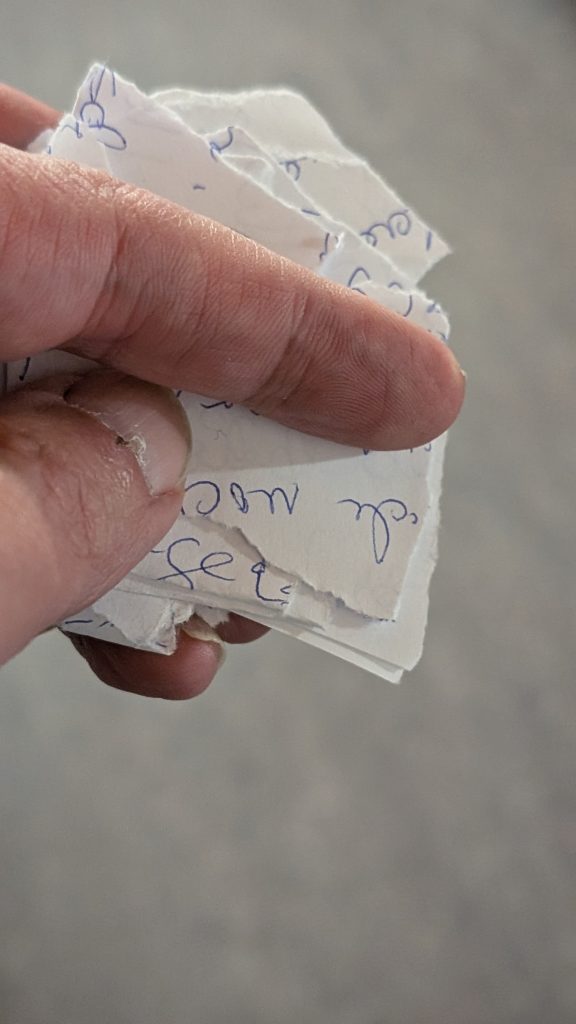Welch ein Tag. Manchmal fragt man sich ja, ob das Universum einen Plan hat, oder ob es einfach nur würfelt – und heute fielen die Würfel eindeutig auf „Mäh“.
Der Morgen begann mit einem kulinarischen Anschlag auf meine Kauwerkzeuge. Das Frühstück präsentierte sich in Form von Brötchen, die in einem früheren Leben sicher gerne Flummis geworden wären. Dazu die übliche Auswahl an „Belägen“, die vermutlich schon seit der Erfindung des Brotes dort liegen. Ein Fest für die Sinne. Nicht.
Die intellektuelle Elite schläft nie Da der Vormittag zur freien Verfügung stand (aka: Langeweile pur), beschloss ich, das Elend einfach wegzuschlafen. Vorhänge zu, horizontale Position eingenommen. Auftritt: Mein Bettnachbar, der Sherlock Holmes der Station. Er sieht mich liegen. Er sieht die zugezogenen Gardinen. Er fragt: „Du willst jetzt schlafen?“ Ich war kurz davor, ihm die Relativitätstheorie zu erklären, entschied mich aber für die einzig logische Antwort: „Nein, ich spiele gerne Tischtennis im Liegen.“ Hat er es verstanden? Unklar. Aber ich bekam meinen Mittagsschlaf.
Kunst am Bau (oder am Brot) Nachmittags stand „Keramik“ auf dem Plan. Meine Motivation bewegte sich im Minusbereich, irgendwo zwischen Wurzelbehandlung und Steuererklärung. Aber man ist ja diszipliniert. Und siehe da: Ich habe mein Meisterwerk vollendet. Bernd das Brot. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich ausgerechnet das depressivste Kastenbrot der TV-Geschichte töpferte und mich danach vor Stolz kaum einkriegte. Dass vier nette Damen in meinem Kurs waren, tat dem Ego natürlich auch keinen Abbruch. Man nimmt, was man kriegen kann.
Slapstick und Krimi-Frust Nach einem Stations-Forum im Schnelldurchlauf (Effizienz ist alles, wenn man eigentlich keine Lust hat) gab es dann doch noch Kultur: Live-Comedy in der Raucherzone. Ein Typ übersieht die Dame hinter sich, sie sagt einen Ton, er vollführt einen Sprung, der physikalisch eigentlich unmöglich sein sollte. Schadenfreude ist eben doch die ehrlichste Freude.
Zum Runterkommen noch den „Tatort“ beendet. Fazit: Eine solide 3 bis 4. Genau wie der Rest des Tages. Nicht schlecht genug für eine Tragödie, nicht gut genug für eine Komödie. Einfach nur… da.
Gesamtwertung des Tages: 3-4. Schauen wir mal, ob morgen wenigstens die Brötchen tot sind, bevor man sie uns serviert.